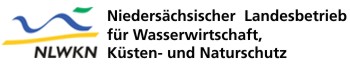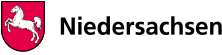Rechtliche Grundlagen
Die Vernetzung von Lebensräumen ist ein naturschutzfachliches Ziel, das nicht erst seit 2002 durch die Aufnahme in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) existiert. Das Ziel eines funktionalen Biotopverbunds ist bereits in der Berner Konvention (1979) sowie in der FFH-Richtlinie (1992) angelegt. Das Niedersächsische Naturschutzgesetz (NNatSchG) ergänzt diese Regelungen auf Landesebene. Im Raumordnungsgesetz (ROG) wird die Schaffung eines Freiraumverbundsystems als „Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung“ definiert, die „anzuwenden und durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren“ ist.
--> Berner Konvention und FFH-Richtlinie
--> Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
--> Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
--> Raumordnungsgesetz (ROG)
Berner Konvention und FFH-Richtlinie
Die Berner Konvention betrachtet die Notwendigkeit der Vernetzung von Lebensräumen von internationaler Ebene in erster Linie vor dem Hintergrund von wandernden Arten, deren Raumanspruch sich über mehrere Staaten ausdehnen kann. Die FFH-Richtlinie hat diese Zielsetzung für die Mitgliedsstaaten der EU weiterentwickelt. Gemäß Artikel 10 der FFH-Richtlinie haben sich die Mitgliedsstaaten verpflichtet „Landschaftselemente zur Verbesserung der Kohärenz von Natura 2000 auszuweisen: Hierbei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z. B. Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmliche Feldraine) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind.“
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
§ 1 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes stellt im Kontext der Gesamtheit der Ziele für Naturschutz und Landschaftspflege grundsätzliche Anforderungen zum Schutz der biologischen Vielfalt mit Bedeutung für den Biotopverbund dar:
Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
- lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,
- Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwirken,
- Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben.
Ein zentrales Instrument, um diese Ziele zu erreichen, ist nach den §§ 20 und 21 des Bundesnaturschutzgesetzes die Entwicklung eines Biotopverbundsystems, das auch zur Umsetzung des Netzes „Natura 2000“ dient. Dieser Zusammenhang zwischen Biotopverbund und Natura 2000 wird im § 21 Absatz 1 explizit zum Ausdruck gebracht. Die Biotopverbundplanung ist eine Kernaufgabe der Landschaftsplanung. § 9 Absatz 3 Nr. 4d des BNatSchG bringt dies explizit zum Ausdruck und stellt auch die direkte Verbindung in großräumiger Hinsicht zu Natura 2000 her sowie in kleinräumiger Hinsicht zur lokalen Biotopvernetzung. Mit der Novelle des BNatSchG 2022 wurde eine 10-jährige Fortschreibungspflicht für die überörtliche Landschaftsplanung eingeführt, so dass die Aktualität der landesweiten und regionalen Biotopverbundplanung somit gewährleistet werden kann.
§ 21 Absatz 2 BNatSchG normiert eine übergreifende Abstimmung der in der Verantwortung der einzelnen Bundesländer liegenden Biotopverbundplanung. Auf LRP-Ebene ist eine planungsraumübergreifende Abstimmung ebenso notwendig, wo die Konnektivität maßstabsbedingt nicht über das landesweite Biotopverbundkonzept abgedeckt wird. Absatz 3 nennt die Bestandteile, aus denen sich der Biotopverbund zusammensetzt, nämlich Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente.
Nach § 21 Absatz 4 BNatSchG sind die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 BNatSchG, durch planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten.
In § 21 Absatz 6 BNatSchG ist die Regelung zur Biotopvernetzung enthalten, durch die „auf regionaler Ebene […] insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind“ geschaffen werden sollen.
Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
Mit der Novelle des NNatSchG zur Umsetzung des „Niedersächsischen Weges“ in Naturschutz-, Gewässerschutz- und Waldrecht wurde ein neuer § 13a in das NNatSchG eingefügt, der ergänzend zu § 20 BNatSchG bestimmt, dass weitere fünf Prozent der Landesfläche der Umsetzung des Biotopverbunds dienen sollen, davon zehn Prozent des Offenlandes. Die Umsetzung soll demnach bis Ende 2023 erfolgen. Ein Weg, wie dieses Ziel so kurzfristig erreicht werden könnte, wird allerdings nicht gewiesen. Bei der Formulierung dieser Regelungen wurde vom Gesetzgeber nicht eindeutig zwischen den Bedeutungsebenen des überörtlichen Biotopverbundes und der lokalen Biotopvernetzung sowie der jeweiligen Funktion von Landschaftselementen unterschieden.
Das Raumordnungsgesetz (ROG) definiert die Grundsätze der Raumordnung, die als „Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung […] anzuwenden und durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren“ sind. Zu diesen Leitvorstellungen gehört § 2 Absatz 2 Nr. 6 entsprechend auch, dem Biotopverbund Rechnung zu tragen, womit ein direkter Bezug zu den diesbezüglichen Regelungen im BNatSchG hergestellt wird. Wegen anderer fachpolitischer Schwerpunktsetzungen im Naturschutz wurde ein erstes landesweites Biotopverbundkonzept zunächst durch die Landesplanung und die Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) angestoßen und 2017 nach dem abgeschlossenen Fortschreibungsverfahren planungsrechtlich wirksam. In die Zeichnerische Darstellung des LROP wurden dabei Vorranggebiete für den Biotopverbund aufgenommen, die sich § 21 BNatSchG entsprechend nach formalen Kriterien aus Schutzgebieten sowie bestimmten Förderkulissen zusammensetzen.
Eine grundlegende Vernetzungsfunktion übernimmt bereits in dieser Konzeption ein Fließgewässerverbund, der sich aus den für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) an prioritären Gewässern, den überregionalen Wanderrouten sowie den Laich- und Aufwuchsgebieten der Fischfauna zusammensetzt. Parallel zum LROP-Verfahren konnten nach einem Landtagsbeschluss 2014 die Arbeiten an der Neuaufstellung des Niedersächsisches Landschaftsprogramms und damit auch an einem fachlich anspruchsvolleren landesweiten Biotopverbundkonzept aufgenommen werden, das 2021 veröffentlicht wurde. Die auf den landesweiten Biotopverbund bezogenen Aussagen des LROP sollen auf dieser Basis im 2023 begonnenen Fortschreibungsverfahren weiter qualifiziert werden.
Die Aufnahme von Darstellungen und gesamtplanerischen Regelungen zum Thema Biotopverbund bindet die Regionale Raumordnung (RROP) daran, diesbezügliche Inhalte zu konkretisieren und bedarfsgerecht auf Basis des Landschaftsrahmenplans (LRP) sowie möglicherweise darauf aufbauender Fachkonzepte zu ergänzen.
Artikel-Informationen
Ansprechpartner/in:
Alexander Harms
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
Göttinger Chaussee 76 A
D-30453 Hannover
Tel: +49 (0)511 / 3034-3017
Fax: +49 (0)511 / 3034-3507