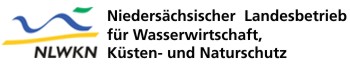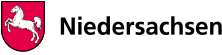Aktuelles aus dem KliMo-Projekt Südheide
19.06.2025
40 Jahre Naturschutzgebiet Großes Moor
Das "Netzwerk Großes Moor Gifhorn", ein Zusammenschluss von im Großen Moor aktiven Vereinen und Behörden, führt 2025 eine Reihe von Veranstaltungen durch. Den Flyer mit den Terminen gibt es hier zum Download.
04.04.2024
Projektbeschleunigung durch Weihnachtshochwasser
Ergiebiger Dauerregen, wie er im Dezember 2023 in Niedersachsen fiel, kann durchaus positive Effekte haben. Aktuell ist dies im Großen Moor zu beobachten. Die kräftigen Niederschläge ließen den Wasserspiegel der vor kurzem noch ausgetrockneten Landschaft so rasant ansteigen, dass viele der Projektflächen erstmals nach ihrer Fertigstellung wieder Wasser führten. Damit wurden auf einen Schlag Wasserstände erreicht, die erst in den kommenden Jahren prognostiziert waren.
Die angelegten Moorflächen wirken wie Polder und konnten nun ihre Retentionsfähigkeiten unter Beweis stellen. Über die verschiedenen Kanalsysteme wird das Wasser im Gebiet gehalten, womit das wiedervernässte Moor auch zum Hochwasserschutz beiträgt. Dies kann zu einer Speicherung und verzögerten Abflusswirksamkeit führen, was die Hochwasserlage gewässerabwärts entspannt.
Erfreulicherweise siedeln sich bereits erste Heidepflänzchen auf dem nassen Torfboden an. Pflanzen haben eine stabilisierende Wirkung auf das Moor sowie die wasserbaulichen Strukturen. Um die Wiederherstellung des Ökosystems zu beschleunigen, wird durch den NABU Gifhorn Torfmoos gezüchtet und angepflanzt. Die Pflanze ist für das Wachstum der Torfschicht im Moor verantwortlich.
Obwohl das Wasser derzeit so hoch steht wie nie zuvor, hat sich der darunter liegende Torfboden noch nicht komplett vollgesogen. Um eine optimale Durchfeuchtung zu erreichen, ist es wichtig, das Wasser möglichst lange auf den Flächen zu halten. Die Vernässung hängt jedoch auch von den Wetterbedingungen in den kommenden Monaten und Jahren ab und ist ein entscheidender Schritt, um den ursprünglichen Zustand des wertvollen Ökosystems wiederherzustellen.
Diese Entwicklung am Großen Moor erzielte durch den aktuellen Bezug zum Hochwasser, aber auch durch die Relevanz im Rahmen des Klimawandels gesteigerte mediale Aufmerksamkeit. Einige der entstandenen Berichte sind hier verlinkt:
19.01.2023
Ausgebaggert – Bauarbeiten für Klimo Südheide beendet
Freude bei allen Beteiligten: Pünktlich zum Abschluss des Projektes konnten im Dezember 2022 die Bauarbeiten im Großen Moor abgeschlossen werden, die im Frühjahr 2022 aufgrund der Witterung abgebrochen werden mussten. So konnten jetzt in der zweiten Bauphase alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.
Im südlichen Teil des NSG „Großes Moor bei Gifhorn“ wurden:
- rd. 3.700 m Torfverwallungen neu errichtet,
- rd. 2.300 m bereits vorhandene Torfdämme ertüchtigt,
- zwei Staubauwerke mit Stahlspundwänden im Triangeler Moorkanal gerammt,
- zwei bestehende Staubauwerke ertüchtigt und
- rd. 2.000 m Fanggraben inkl. eines Stahlbetondurchlasses mit Staumöglichkeit gebaut.
Der Erfolg der Maßnahmen wird sich erst nach einigen Jahren zeigen. Im Gegensatz zum Jafelbachgebiet sind hier keine Reste des ursprünglichen Moores mehr vorhanden. Es muss quasi bei null starten und neu wachsen. Dazu wird zunächst der Triangeler Moorkanal angestaut, um die neu geschaffenen Polderflächen mit Wasser zu füllen. Dort können sich dann Torfmoose ansiedeln und in den nächsten Jahrzenten ein neues Moor schaffen.
Alle Maßnahmen haben aber auch jetzt schon direkte positive Effekte: Der ausgetrocknete Torf kann sich wieder mit Wasser vollsaugen, wodurch die Torfzehrung unterbunden und die CO2-Freisetzung gestoppt wird. Der Grundwasserstand wird angehoben und durch den Wasserrückhalt werden die Auswirkungen von Trockenphasen abgeschwächt. Auf den feuchten, nicht überstauten Böden können sich typische Pflanzengesellschaften wie Moorheiden und Moorwälder ausbreiten. Von den offenen Wasserflächen, die vor allem im Herbst und Frühjahr auftreten, profitieren Vogelarten wie Kranich, Kiebitz und Bekassine.
15.11.2022
Aus neu mach alt?
Die Bauarbeiten im Naturschutzgebiet „Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach“ sind abgeschlossen.
Corona-Pandemie, Orkane und Starkregen: Nach zwei ereignisreichen Jahren und drei umfangreichen Bauphasen konnten die Arbeiten rund um den Jafelbach und seine Nebengewässer im November 2022 abgeschlossen werden. Den herausfordernden Umständen zum Trotz wurden fast alle geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt.
Für einen Wiederanstieg des Grundwassers zum ursprünglichen Niveau sind nun alle Voraussetzungen geschaffen: Wo einst Bachläufe vertieft und mit zusätzlichen Gräben in die Moorkörper verlängert wurden, präsentieren sich Bachbetten nun wieder abgeflacht. Gewässerläufe sind in ihre ursprünglichen Verläufe zurückverlegt und künstlich angelegte Gräben verfüllt worden. Alte Durchlässe in Wegen und Dämmen wurden verschlossen und angepasste Furten und Durchlässe in die neuen Bachverläufe eingebaut. Nicht mehr genutzte Forstwege im Moor wurden zurückgebaut. Durch die neu geformten Gewässerverläufe, die sich nun durch die Landschaft schlängeln, und die Anhebung der Bachbetten auf ihr ursprüngliches Niveau fließen die Heidebäche nun wieder langsam durch das Gelände.
Erste Erfolge werden sich rund um den Jafelbach voraussichtlich in diesem Winter zeigen, da durch die renaturierten seichten Heidebäche Jafelbach und Kucksmoorgraben nun weniger Wasser aus dem Gebiet abfließt. Auf diese Weise kann ein größeres Wasservolumen die über Jahrhunderte trockengelegten Moorkörper sukzessiv wiedervernässen.
Dieser Rückbau zu ursprünglichen Bedingungen schützt aber auch die noch intakten Bereiche des Kucks- und Jafelmoores. Sie können so als wichtige Keimzellen wertvoller, moortypischer Tier- und Pflanzenarten für die Wiederbesiedlung der über die Jahre wieder zunehmenden naturnahen Moorflächen dienen.
Insgesamt wurden
- 7,6 km Hauptgräben und 5,5 km Nebengräben verfüllt oder gekammert,
- 13 nicht mehr erforderliche Durchlässe und 600 m Wegedämme zurückgebaut,
- sieben an den natürlichen Gewässerverlauf angepasste Durchlässe und drei Furten neu gebaut und
- die Heidebäche in ihre ursprünglichen Bachbetten zurückverlegt.
15.08.2022
Trockene Moore – brandgefährlich
Der Sommer 2022 war einmal mehr geprägt von großer Hitze und lang anhaltender Trockenheit. Entsprechend häuften sich die Meldungen über Brände in Wäldern und auf Moorflächen. Am 21.07.2022 ereilte auch das Projektteam die Schreckensmeldung: ein Brand unmittelbar im Projektgebiet im Großen Moor bei Gifhorn.
Donnerstagnachmittag wurde der Brand gemeldet – Auslöser für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Mit Hilfe von 900 Einsatzkräften, Landwirtinnen und Landwirten sowie Anwohnenden konnten knapp vier Hektar brennende Torffläche letztendlich gelöscht werden. Bis in den Sonntagmorgen hinein dauerte die Brandbekämpfung an.
Doch warum brauchte es so lange, bis die Löscharbeiten beendet waren?
Die Trockenlegung der Moore diente ursprünglich unter anderem zur Torfgewinnung: Der abgebaute Torf kam als beliebtes Heizmaterial zum Einsatz. Trockener Torf brennt also herausragend gut. Zudem sind Hochmoore meist mehrere Meter mächtig, wodurch die trockengelegten Torfschichten tief in den Untergrund reichen. In diese unterirdischen Torfschichten frisst sich das Feuer bei einem Moorbrand regelrecht hinein. Oberirdisch ist zum Teil kein Brand erkennbar, doch unterirdisch schwelen Glutnester, aus denen das Feuer jederzeit erneut ausbrechen kann.
So geschah es auch im Großen Moor. Nur durch den Einsatz von Wärmebildkameras konnten diese unterirdischen Glutnester aufgespürt werden. Mit Erfolg: Sonntagmorgen galten alle Glutnester schließlich als gelöscht. Doch bei einer gemeinsamen Begehung der Brandfläche am darauffolgenden Mittwoch entdeckten Feuerwehr und NLWKN erneut einen qualmenden Bereich, der zum Glück sofort gelöscht werden konnte. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie gefährlich und unberechenbar Moorbrände trotz modernster Technik noch immer sind.
Was kann gegen diese Gefahr getan werden?
Dass es bei großer Hitze und anhaltender Trockenheit in der Natur zu Bränden kommt, lässt sich kaum verhindern. Bei Mooren kann man das Risiko jedoch erheblich senken, indem man die Moore wiedervernässt. Zum einen brennt feuchter Torf nicht gut. Zum anderen dienen intakte Moore als Wasserspeicher: In der feuchten Jahreszeit nehmen sie Wasser auf wie ein Schwamm. In der trockenen Jahreszeit geben sie dieses langsam an die Umgebung ab, sodass auch die Bereiche um ein Moor herum langsamer austrocknen.
Beim Brand im Großen Moor war übrigens ein wenig Glück im Unglück mit dabei: Keine der bereits umgesetzten Baumaßnahmen war betroffen und auf der Brandfläche sind auch keine Bauarbeiten vorgesehen. Zudem handelt es sich bei den betroffenen Biotopen um Heideflächen. Besenheide gehört zu den sogenannten „Brandkeimern“, also Pflanzenarten, deren Fortpflanzung und Erhaltung durch Brände sogar noch begünstigt wird.
09.05.2022
Wenn der Klimawandel das Überleben schwer macht…
Knapp ein Drittel der in Niedersachsen vorkommenden Libellenarten werden in der aktuellen Roten Liste als bestandsgefährdet verzeichnet. In Zeiten des Klimawandels haben es die auf Moorlebensräume spezialisierten Arten besonders schwer.
Die Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia) ist eine von insgesamt zehn moorliebenden Libellenarten, deren regionaler Bestandstrend von den zunehmend spürbaren Auswirkungen des globalen Klimawandels nachweislich negativ beeinträchtigt wird. Die Vorkommen der Kleinen Moosjungfer wurden in Niedersachsen zunächst vor allem durch die Trockenlegung und Zerstörung von Moorlebensräumen zurückgedrängt. Bereits vor den Dürresommern 2018-20 war landesweit ein deutlicher Bestandsrückgang dieser Art zu verzeichnen, weshalb die Kleine Moosjungfer in der aktuellen Fassung der Roten Liste (Stand 12/2020) von Kategorie 3 „Gefährdet“ in die Kategorie 2 „Stark gefährdet“ heraufgestuft werden musste.
Die zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klimawandels machen der Kleinen Moosjungfer das Überleben noch zusätzlich schwer: Die Larven dieser Großlibelle benötigen eine relativ lange Entwicklungszeit von 2-3 Jahren, bis sie zur erwachsenen Libelle herangereift sind. Das mehrjährige Austrocknen der Reproduktionsgewässer (stehende, relativ saure Moorgewässer) hatte in Niedersachsen weitere drastische Bestandseinbrüche und mancherorts sogar das lokale Verschwinden dieser Art zur Folge.
Die Wiedervernässungs-Maßnahmen in den ausgewählten KliMo-Projektgebieten der Südheide „Großes Moor“ bei Gifhorn und „Jafelbach“ sollen nicht zuletzt auch der Kleinen Moosjungfer artgerechte Lebensräume bieten und zur Sicherung eines stabilen regionalen Bestandes dieser Art im südöstlichen Niedersachsen beitragen.
04.04.2022
Baufortschritte im Großen Moor auf Erfolgskurs
Um das Frühlingserwachen von Flora und Fauna nicht zu stören, pausiert mit Beginn der Brut- und Setzzeit der Baustellenbetrieb zur Wiedervernässung des südlichen Gebietsteils im Natura 2000-Gebiet „Großes Moor bei Gifhorn“. Tatsächlich kamen bereits Ende Februar die ersten Kraniche wieder zurück, um sich mit weit hörbaren, kranichtypischen Trompetenrufen die besten Brutplätze im Großen Moor zu sichern.
Die geplanten Maßnahmen kamen über die Wintermonate mit großen Schritten voran und führten trotz durchziehender Orkantiefs zu sehr guten Ergebnissen:
- Insgesamt wurden 2.600m Torfverwallungen durch Spezialraupen mit extra breiten Moorlaufwerken aufgeschoben und neu errichtet. Die höheren Außen- und etwas niedrigeren Zwischenverwallungen haben die Funktion, das Wasser auf kleineren „Polderflächen“ zurückzuhalten, so dass die ausgetrockneten Moorböden trotz unterschiedlicher Geländehöhen möglichst gleichmäßig vernässt werden.
- Um den Wasserrückhalt in den Vernässungsflächen zu gewährleisten, wurden zudem rund 1.700m der bereits bestehenden Torfdämme ertüchtigt. Hierbei wurde durch Torfumlagerung und -verdichtung sichergestellt, dass das Wasser nicht über Wurzellöcher oder Schwundrisse abfließen kann. Aufgrund der langen Trockenheit sind die Torfböden des Großen Moores so stark ausgetrocknet und geschrumpft, dass teilweise metertiefe Schwundrisse entstanden sind.
- Das Große Moor wird seit mehr als hundert Jahren durch ein großflächiges Drainagesystem aus Kanälen und Gräben entwässert, um das Gebiet für den Torfabbau oder landwirtschaftliche Nutzung urbar zu machen. Um die weitere Entwässerung zu unterbrechen wurden im zentral verlaufenden Entwässerungskanal - dem Moorkanal - Spundwände gerammt und mehrere Stauwehre errichtet, die das abfließende Wasser zukünftig im Moor zurückzuhalten und reguliert auf den ausgetrockneten Moorflächen verteilen. Die Aktivierung der Stauwehre ist zu einem späteren Zeitpunkt in 2022 vorgesehen.
- Zur Sicherung der umgebenden Privatgrundstücke und Wirtschaftsflächen wurde ein zusätzlicher Abfanggraben gezogen, so dass auftretende Hochwasserspitzen schadlos aus dem Gebiet abgeführt werden können.
- Abschließend wurden die Torfverwallungen mit Heide Mahdgut eingestreut, um ihren Bewuchs zu intensivieren. Das regionale Saatgut enthält moortypisches Samenpotential und soll des Weiteren der Verbreitung von invasiven Arten Einhalt gebieten.
Die Bauarbeiten im Großen Moor liegen gut in der Planung, sind aber noch nicht abgeschlossen. Der Bau von weiteren 1.500m Torfverwallungen steht für den kommenden Spätsommer/ Herbst noch aus.
02.03.2022
Auf dem Holzweg unterwegs…
Ausgerechnet im regenreichen Winter mit tonnenschweren Baumaschinen ins Moor aufzubrechen, ist eigentlich keine glorreiche Idee. Und so hielten die Bauvorhaben zur Wiedervernässung des Kucksmoores im KliMo Projekt Südheide für die Mitarbeitenden des Bauunternehmens in den Wintermonaten besondere Herausforderungen unter erschwerten Bedingungen bereit: Das erklärte Ziel war es, einen knapp 900 m langen Abschnitt des Entwässerungsgrabens mitten im durchweichtem Moor mit Torf zu verschließen.
Bei Pflege- und Entwicklungsvorhaben des Naturschutzes wird es manchmal notwendig, die Umsetzung von Baumaßnahmen in die Wintermonate zu verlegen, obwohl Witterung und Wasserstände in dieser Jahreszeit bautechnisch eher ungünstig sind. Dies begründet sich durch artenschutzrechtliche Vorgaben. Da sich ein Großteil der Flora und Fauna in den kalten Monaten in die Winterruhe zurückgezogen hat, werden Arten und Lebensräume durch die Bauumsetzung weniger stark gestört bzw. geschädigt. Während der regenreichen Wintermonate steigen die Grundwasserstände in den Gebieten gewöhnlich rasch an, sodass die Böden wassergesättigt werden und eine zunehmend geringere Tragfähigkeit aufweisen.
In einigen Bereichen des Kucksmoores sind 4-5 m mächtige Torfauflagen mit Relikten der ursprünglichen Moorvegetation vorzufinden, z. B. Vorkommen der FFH-Lebensraumtypen „Lebende Hochmoore“ (LRT 7110), Übergangsmoore mit Schwingrasen (LRT 7140) oder Moorwälder (LRT 91D0). Nach FFH-Richtlinie sind all diese Lebensraumtypen mit höchster Priorität zu erhalten bzw. in einen günstigen Erhaltungszustand zu entwickeln. Diesem Anspruch kommt das KliMo Projekt nach, indem wirkungsvolle Maßnahmen zur langfristigen Stabilisierung des Wasserhaushalts im Gebiet umgesetzt werden. Gleichzeitig ist es der Anspruch, dass die wertvollen Biotope bei der Maßnahmendurchführung möglichst wenig geschädigt werden.
Um diesen Ansprüchen zu genügen, müssen die Baumaschinen im Natur- und Landschaftsbau strenge Auflagen hinsichtlich des maximalen Auflastdrucks pro Quadratzentimeter erfüllen, sodass die Böden nicht übermäßig verdichtet bzw. die Vegetationsdecke geringstmöglich geschädigt wird. Um die ökologisch sensible Moorvegetation minimal zu belasten, wurden auch die Transportwege für den Torf möglichst kurz und schmal konzipiert. Hierfür wurden 4-5m breite, temporäre Transporttrassen eingerichtet, welche aus mehrlagig übereinander geschichteten Fichtenstammabschnitten bestanden. Bereits seit Jahrhunderten ermöglicht diese durch Rundholz oder Bohlen befestigte Wegbauweise dem Menschen sicheren Zugang in das Moor. Die dazu verwendeten Fichtenstämme wurden vorab aus dem Projektgebiet gewonnen und waren überwiegend dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Sie liegen nach dem Rückbau der Trasse umgelagert für den nächsten Bauabschnitt zur Wiederverwendung bereit.
Auf diesen sogenannten Knüppeldämmen balancierten sich Drehkranz-Kettenbagger und -Raupendumper Meter um Meter ins Moor, um den streckenweise stark ausgekolkten Kucksmoorgraben auf einer Gesamtlänge von 900 m zu verschließen. Mit beginnender Vegetationsperiode wird sich die Moorvegetation im Bereich des verschlossenen Grabens und der Transporttrasse erholen und regenerieren. Zukünftigen Moorbesuchern wird es nur schwer vorstellbar sein, welcher Aufwand in den nasskalten Wintermonaten zum Schutze der sensiblen „Heile-Haut-Flächen“ im Rahmen der Wiedervernässung betrieben wurde02.12.2021
Gleisbauarbeiten am Jafelbach
Die Renaturierungsmaßnahmen zur Wiedervernässung der Moore im Naturschutzgebiet „Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach“ hielten hydrologische und bautechnische Herausforderungen bereit.
Die Gewässersohle des von Menschenhand stark begradigten und eingetieften Kucksmoorbachs (Kucksmoorgraben) sollte im Unterlauf wieder angehoben werden, damit sich der Quellpunkt des Kucksmoorbachs an seinen natürlichen Ursprungspunkt zurückverlagern kann. Eine zwingende Zielsetzung zur Wiederherstellung einer ganzjährigen und natürlichen Wassersättigung in Moor- und Auenböden des Projektgebietes, denn nur so kann sich eingespeistes Niederschlags- und Grundwasser auf ein ursprüngliches Maß einpegeln und oberflächennah der historischen Aue folgen.
Zur Umsetzung dieses Zielvorhabens war es zunächst von Priorität, ein Durchlassbauwerk unterhalb einer, das Schutzgebiet querenden, Bahntrasse der Osthannoverschen Eisenbahngesellschaft OHE GmbH (seit 2022 SinON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH) zu erneuern, um die Gewässersohle auf ein höheres Niveau einzustellen. Während der Planungs- und Umsetzungsphase wurde dieses Vorhaben mit dem damaligen Trassenbetreiber OHE GmbH, der zuständigen Landeseisenbahnaufsicht (LEA) und anderen Anliegern abgestimmt und Ende November 2021 nach kurzer Bauzeit erfolgreich umgesetzt.
Um die Unterbrechung des Bahnverkehrs und die Bereitstellung des hierfür benötigten Schwerlastenkrans auf ein Minimum zu reduzieren, lief der Baustellenbetrieb selbst am Wochenende nahezu 24/7 auf Hochtouren. Das Gelingen dieser Maßnahme erforderte eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Akteure sowie deren spezielle Sachkunde im Gleisbau, Wasserbau und Ingenieurswesen. Nach fünftägiger Bauzeit konnte der Schienenbetrieb auf der Strecke Celle - Wittingen wiederaufgenommen werden.15.10.2021
Baustart für den Naturschutz
Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt und die ersten Bäume ihre Herbstfärbung zeigen, ertönt auf Äckern und Straßen das Brummen der Erntemaschinen. Aber auch auf mancher Naturschutzfläche schlägt genau jetzt die Stunde der schweren Baugeräte. Der Grund: Ab Spätsommer beginnt ein nur schmales Bauzeitfenster für den Naturschutz. Doch warum ist der richtige Zeitpunkt so wichtig, wenn im Naturschutz gebaut wird?
Die Antwort ist einfach und komplex zugleich: Wenn der Naturschutz in den Schutzgebieten die Bagger rollen lässt, soll immer ein Mehrwert für die Natur entstehen. Deshalb muss jeder Eingriff vorab umfassend geprüft und abgewogen werden. Dabei gilt es, vor allem artenschutzfachliche Interessen gut miteinander abzuwägen. Eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen gibt hierfür den Rahmen vor.
Die wohl bekanntesten Regelungen sind der Allgemeine Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen, welche die Rodung von Gehölzen außerhalb des Waldes nur im Zeitraum vom 01.10. - 28./29.02 erlaubt oder auch die vom 01.04. bis 15.07. eines jeden Jahres festgesetzte Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, in der Hunde in der freien Landschaft an der Leine zu führen sind. Vor dem Hintergrund dieser Regelungen werden die meisten Bauarbeiten im Naturschutz im Herbst und Winter in der Zeit vom 01.10 bis 28/29.02 durchgeführt.
Doch sind dies nicht die einzigen Regelungen, die bei Bauarbeiten im Naturschutz berücksichtigt werden müssen. Es kommt recht häufig vor, dass die Bedürfnisse verschiedener Artengruppen im Konflikt miteinander stehen (naturschutzfachliche Zielkonflikte). Im Falle eines solchen Zielkonflikts, gilt es, die für alle Artengruppen beste Kompromisslösung naturschutzfachlich abzuwägen. Um herauszufinden, welche Artengruppen im Gebiet zu berücksichtigen sind, erfolgt i. d. R. eine ökologische Untersuchung des Baufeldes und seiner Umgebung. Dabei wird vor allem erfasst, welche besonders schützenswerten Arten von den Bauarbeiten betroffen sein könnten. Zugleich sucht man nach Möglichkeiten, wie der Eingriff möglichst schadlos für die betroffenen Artengruppen durchgeführt werden kann. Eine weitere Einengung des Zeitfensters für die Bauumsetzung kann hierbei manchmal schon ein wichtiger Planungsschritt sein.
Auch für die Projektgebiete des Klimo Südheide-Projekts wurden entsprechende Abwägungen getroffen. Für die Vorhaben im Projektgebiet rund um den Jafelbach hat sich das Bauzeitfenster vom 01.10.2021-28.02.2022 als geeignet herausgestellt. Lediglich die mit dem Herbst einsetzende feuchtere Witterung könnte bei den Bauarbeiten selbst problematisch werden.
Im Großen Moor wurde hingegen entschieden, mit den Arbeiten deutlich früher zu beginnen: Die Bautrassen für die Errichtung von Torfverwallungen sollen von Gehölzen befreit werden (überwiegend junge Birken) – ein wichtiger Vorbereitungsschritt für die spätere Wiedervernässung des Moores. In diesen Gehölzbereichen können potentielle Habitate für Reptilien, Säugetiere und Vögel liegen, z. B. Bruthöhlen für Vögel oder Überwinterungsquartiere von Reptilien in Wurzelhöhlen der Bäume. Zum Schutz von Brutvögeln und Reptilien war es entsprechend erforderlich, das Bauzeitfenster nach Ende der Brutzeit, aber noch deutlich vor dem einsetzenden Herbst beginnen zu lassen, damit die Rodung der Gehölze im Baufeld abgeschlossen ist, noch bevor sich die Eidechsen und Schlangen ihre Winterquartiere zurückziehen und dort in Winterstarre fallen.
14.07.2021
Moor vs. Wald? Förster für Waldökologie Christoph Rothfuchs im Interview (Teil 2)
Mit welchen Folgen des Projekts rechnen sie in Bezug auf den vorhandenen Wald?
Wenn man Auen- und Bruchwälder wieder vernässt, verändert man die Standortbedingungen genauso grundlegend wie diese in der Vergangenheit durch die Anlage von Entwässerungsgräben verändert wurden. Solche nachhaltigen Veränderungen des Wasserhaushaltes führen in der Regel zum Absterben der aktuellen Bestockung, weil den Bäumen die Zeit fehlt, sich an die veränderten Wasserstände anzupassen. Später werden sich in den Auen wieder Baumarten einfinden, die an hohe Wasserstände angepasst sind, so dass sich wieder standortgerechte Bruch- und Auwälder bilden.
Die Moore im Gebiet waren ursprünglich überwiegend waldfrei. Erst durch die starke Entwässerung wurde ein Waldwachstum auf diesem Standort überhaupt möglich. Der torfige Moorkörper zerfiel und setzte gebundenes CO2 frei. Dieser fortschreitende Zersetzungsprozess wird durch die Wiedervernässung gestoppt und die reaktivierten Moore werden zukünftig voraussichtlich wieder waldfrei werden. Damit entwickeln wir im Projekt sehr dynamische und besonders schützenswerte Lebensräume.
Waldfreie Flächen klingen erstmal nicht nach einer Zielsetzung für die Forstwirtschaft. Trotzdem stehen Sie als Förster mit Überzeugung hinter dem Projekt. Warum?
Mit Blick auf den bevorstehenden Klimawandel bin ich davon überzeugt, dass wir unsere bestehende Landschaftsentwässerung umgestalten müssen. Wir müssen, dort wo es passt, das Wasser in der Landschaft halten.
Daher haben die NLF beschlossen, die feuchten Landeswaldflächen im Jafelbachsystem im Rahmen der Biodiversitätsstrategie der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft sich selbst zu überlassen und haben sie aus der Bewirtschaftung genommen. Auf den Flächen können künftig die natürlichen Prozesse (absterben und neu aufwachsen) ungehindert ablaufen. Die NLF werden diese Prozesse durch die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen langfristig beobachten und dokumentieren lassen.
Zusätzlich gehen wir davon aus, dass die höheren Grundwasserstände im Gebiet positive Effekte auch für die übrigen, etwas höher gelegenen Waldstandorte haben werden, da die Bäume auch in Dürrezeiten noch erreichbares Grundwasser vorfinden. Die letzten drei Jahre haben uns eindrücklich vor Augen geführt, wie sich unser Klima in naher Zukunft ändern kann. Mit der Wasserrückhaltung im Jafelgebiet gehen wir von zukünftig stabileren Grundwasserständen aus, wovon auch die bewirtschafteten Waldflächen sowie die umgebende Landschaft langfristig profitieren werden.
Herr Rothfuchs, ihre Darstellungen zeigen, dass Moorrenaturierung mehr als nur Klimaschutz ist und sich Moor und Wald nicht ausschließen, sondern der Wald sogar vom Moor profitieren kann. Vielen Dank für dieses Interview und den Einblick in die Motivation der NLF als Kooperationspartner des NLWKN in diesem Projekt.
14.04.2021
Moor vs. Wald? Förster für Waldökologie Christoph Rothfuchs im Interview (Teil 1)
Moore und Wälder sind wertvolle Ökosysteme, gerade in Bezug auf den Klimawandel. Auf vielen entwässerten Moorstandorten haben sich heute Wälder entwickelt. So auch in unserem Projektgebiet rund um den Jafelbach und seinen Nebengewässern. Stehen also Wald- und Moorentwicklung zwangsläufig in Konkurrenz zueinander? Im Interview steht Förster für Waldökologie Christoph Rothfuchs vom Forstamt Unterlüß Rede und Antwort.
Herr Rothfuchs, Sie begleiten als Förster für Waldökologie dieses Moorrenaturierungsprojekt für unseren Kooperationspartner, die Niedersächsischen Landesforsten (NLF). Warum beteiligen sich die Landesforsten an diesem Projekt?
Mit ihrem Engagement verfolgen die Landesforsten das Ziel, die grundwasserabhängigen Lebensräume - also die Moore und Bachauen der Nebengewässer der Jafel - grundlegend wiederherzustellen. Ein Wassereinzugsgebiet endet aber nicht an Eigentumsgrenzen. Deshalb musste das Projekt großräumiger und mit einem entsprechenden finanziellen Umfang anlegt werden. Dies hätten die Niedersächsischen Landesforsten alleine nicht leisten können. Angesichts gemeinsamer Ziele hat der NLWKN die Trägerschaft des Projektes übernommen. Im Wesentlichen geht es beiden Partnern darum, klimaschädliches CO₂ in den Moorböden zu binden und den Schutzzweck der FFH-Richtlinie und des Naturschutzgebietes auf den Flächen der NLF zu gewährleisten.
Sie sprechen die FFH-Richtlinie an. Welchen Einfluss hatten die Ziele der Richtlinie auf die Entscheidung, dieses Projekt durchzuführen?
Durch die großräumige Entwässerung unserer Landschaft wurden intakte Moore, Bruch- und Auwälder nicht nur landesweit, sondern europaweit immer seltener. Es verwundert deshalb nicht, dass ihr Erhalt oder ihre Wiederherstellung seit 2000 auch eine wichtige Zielsetzung der FFH-Richtlinie ist. Das Land Niedersachsen zog bereits 1994 ähnliche Konsequenzen: Damals wurde das LÖWE-Programm beschlossen (Langfristige Ökologische Waldentwicklung), welches für die NLF bis heute bindend ist. Der erste von insgesamt 13 Grundsätzen hält fest, dass in entwässerten Feuchtbereichen nach Möglichkeit die natürlichen Wasserverhältnisse wiederherzustellen sind.
Lesen Sie Teil 2 des Interviews ab Mai an dieser Stelle!
17.03.2021
(Vor-)Frühlingsgefühle im Großen Moor
Kaum hat sich die weiße Pracht des vergangenen Monats in Wasser aufgelöst, erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. Das zeigt sich auch in unseren Projektgebieten: Besonders im Großen Moor wird derzeit viel Lärm um den Frühling gemacht, denn die abwechslungsreiche Landschaft zieht so manchen Vogel an. Schon die ersten gefiederten Besucher des Jahres beweisen dabei eindrucksvoll, warum die Fläche als EU-Vogelschutzgebiet so schützenswert ist: Auf den großen, feuchten Grünlandflächen kann man die mittlerweile wieder in größeren Zahlen vorkommenden Kraniche bei der Nahrungssuche beobachten. Die vielen Gewässer im Naturschutzgebiet bieten ihnen gute Rast- und Brutbedingungen. Diese Vogelart wurde durch die allgemeine Entwässerung der Landschaft stark zurückgedrängt und breitet sich erst seit wenigen Jahren wieder in Nord- und Ostdeutschland aus.
Doch auch in den Wäldern des Gebiets ist ganz schön was los! Obwohl der Kleinspecht noch nicht selten ist, bekommt man diesen ca. spatzengroßen Vogel normalerweise selten zu Gesicht. Doch während der Balz im Frühjahr macht er mit seinem Rufen und Klopfen auf sich aufmerksam.
Auch wenn Vögel die wohl auffälligsten Frühlingsboten sind, zeigt sich der Wandel der Jahreszeiten auch bei anderen Artengruppen, z. B. den Pflanzen ganz deutlich. Viele Bäume blühen bereits. Die ersten Frühblüher stecken ihre Köpfe aus der Erde. Und sobald die Temperaturen stabiler im Plusbereich liegen, werden auch die Amphibien in den Chor der Balzrufe einstimmen.
15.02.2021
„Moor to do“ unter weißer Pracht
Vor dem Frühling bescherten uns ein paar herrliche Wintertage noch einmal viel Schnee. Die Projektgebiete zeigen sich entsprechend in weißer Pracht. Unter der pulvrigen Decke verbergen sich allerdings zwei Projektgebiete, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Während das Gebiet rund um den Jafelbach in großen Teilen bewaldet ist, erscheint das Große Moor sehr offen und weitläufig.
Diese unterschiedlichen Erscheinungsbilder weisen schon auf die verschiedene Entstehungsgeschichte der beiden Moorgebiete hin: Im Jafelgebiet haben sich an den Quellen und Auen der Bäche in flachen Geländemulden so genannte Quell- und Durchströmungsmoore gebildet. Diese Moore werden also vom austretenden Grundwasser und den Bächen im Gebiet gespeist.
Das Große Moor bei Gifhorn hingegen ist entstehungsgeschichtlich ein ganz anderer Moortyp – ein sogenanntes Hochmoor. Über Jahrtausende hinweg haben sich hier immer mächtigere Torfschichten bilden können, sodass das Moor wortwörtlich „hoch“ gewachsen ist. Dadurch wird die Vegetationsdecke des Hochmoores kaum mehr vom anstehenden Grundwasser, sondern fast ausschließlich durch Regenwasser versorgt.
Die mächtigen Torfschichten wurden großflächig abgebaut, so dass sich das ursprünglich nach oben gewölbte Moorgebiet heute eben bis ausgekuhlt zeigt. Da im Gebiet ein Großteil des Torfkörpers zwischenzeitlich abgetragen wurde, gestaltet sich die Renaturierung dieses Moores deutlich herausfordernder als im Jafelgebiet: Dort muss lediglich die Entwässerung des noch vorhandenen Torfkörpers beendet werden.
Im Großen Moor genügt es dagegen nicht, für die Renaturierung Entwässerungsgräben zu verfüllen. Wie an vielen Stellen in dem Gebiet schon sehr gut ersichtlich ist, müssen für die Hochmoorrenaturierung sogenannte „Pütten“ angelegt werden. In diesen teichartigen Wannen kann sich das Regenwasser sammeln – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die torfbildenden Sphagnum-Moose wieder ansiedeln können. Dieser Prozess lässt sich in seinen unterschiedlichen Entwicklungsstadien in den bereits angelegten Pütten gut nachvollziehen. Natürlich nur, wenn die Landschaft nicht gerade von einem weißen Schneekleid bedeckt ist.
Das KliMo-Projekt beabsichtigt, Wasser des Moorkanals über Stauanlagen auf große Teilflächen des Großen Moores zu leiten und diese teilweise zu überstauen. Dazu werden alte Torfwälle im Gebiet ertüchtigt und neue Wälle gebaut. Bis in diesen Wannen ein funktionsfähiges Moor mit Höhenwachstum entstanden ist, werden mehrere hundert Jahre vergehen: Pro Jahr wächst der Torfkörper nur ca. 1 Millimeter in die Höhe!
22.01.2021
Moorschutz unter Strom?Wasser und Strom – das ist zusammengenommen selten eine gute Idee. Im Moorschutz stellen Stromleitungen aber noch aus einem ganz anderen Grund oftmals eine echte Hürde dar – so auch bei unserer nächsten kleinen Baustelle im Projektgebiet: Hierbei muss der Netzbetreiber LSW für unser Ziel eine Mittelspannungsleitung verlegen. Doch was haben Stromleitungen überhaupt mit Moorschutz zu tun? Der Grund ist ganz praktischer Natur: Denn Trassen für Strom, Gas und Wasser werden häufig in oder neben Wegen verlegt. So auch im Falle des Kucksmoordamms.
Im Kucksmoordamm stellt dieser Dammweg jedoch eine Fließbarrieren für das Wasser dar: Er zerschneidet das Moor so in zwei Teile. Das Wasser kann nur über den Kucksmoorgraben, der durch einen kleinen Rohrdurchlass durchgeführt wird, in den anderen Moorbereich abströmen. Durch die linienhafte, tiefe Grabenführung kann sich das Wasser also nicht flächig im Moor verteilen, sondern strömt nur schnell hindurch, weshalb die Moorfläche zunehmend austrocknet.
Die Niedersächsischen Landesforsten wollen den Kucksmoordamm zukünftig nicht mehr forstwirtschaftlich nutzen, sodass es möglich ist, den Kucksmoordamm im zweiten Bauabschnitt im Spätsommer dieses Jahres vollständig zurückzubauen. Bei diesen Rückbauarbeiten hätte die in ca. 90 cm Tiefe liegende Leitung im schlimmsten Fall beschädigt werden können. Eine denkbare Konsequenz: Stromausfälle in Steinhorst! Daher war es vorausschauend notwendig, die Leitung auf eine Tiefe von drei Metern zu verlegen, sodass sie durch die Bauarbeiten nicht mehr beschädigt werden kann.
Spannend ist der Prozess, mit dem die Leitung verlegt wird: Durch eine sogenannte Spülbohrung wird zunächst ein Leerrohr von einer Baugrube zur anderen eingezogen. In diesem wird in einem zweiten Schritt die Leitung verlegt. Für die Verlegung der Leitung mit einer Länge von 120 m benötigen die Fachleute rund eine Woche.
Wie wichtig der Abbau von Fließbarrieren für die Landschaft ist, zeigt sich im wasserreichen Frühjahr sehr gut an den bereits fertiggestellten Bauwerken: Während der Wald zu Beginn der Bauarbeiten noch sehr trocken war und man sich nur schwer vorstellen konnte, dass hier mal Moor war und wieder entstehen soll, verteilt sich nun Wasser in der Fläche und fließt durch die neuen Bauwerke langsam von Ost nach West.
18.12.2020
Stahlgiganten im Moor
Heute war ein aufregender Tag auf der Baustelle: Mit einem Kran mit 100 Tonnen Traglast wurden 14 Tonnen
schwere Durchlassbauwerke in den Langen Damm eingebaut. Durch diese sollen der Jafelbach und der Kucksmoorgraben künftig wieder in ihren natürlichen Betten unter dem Forstweg hindurchgeführt werden.
Bei den ungewöhnlichen Arbeiten auf der Baustelle dabei: ein Film-Team vom NDR. Gefilmt wurde für einen dreiminütigen Beitrag in der Sendung „Hallo Niedersachsen“. Die Dreharbeiten waren auch für uns sehr spannend. Im Rahmen des Interviews galt es, Fragen wie „Warum müssen Moore nass sein?“, „Wie hängen die technischen Bauwerke und der Moorschutz hydrologisch und ökologisch zusammen?“ und „Welchen Nutzen hat der ganze Aufwand für den Klimaschutz?“ zu beantworten. Gar nicht so einfach, so komplexe Themen in derart kurzer Zeit zu behandeln. Wir sind gespannt, wie die vielen Filmaufnahmen und langen Interviews im finalen Beitrag umgesetzt werden!
Insgesamt wurde der erste Bauabschnitt sehr schnell und ohne Schwierigkeiten fertiggestellt. Der Bau von Sickerdurchlässen, Furten und Großdurchlässen bereitet auf die Rückverlegung des Jafelbachs in sein natürliches Bachbett vor, denn der Bach muss in seinem Verlauf mehrere Barrieren in Form von Wegen überwinden. Wöchentlich konnte der Fortschritt des Wiedervernässungsvorhabens bewundert werden. Bereits in wenigen Tagen sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.
10.11.2020
Startschuss am Jafelbach
Diesen Monat starten die ersten Bauarbeiten im Projektgebiet im NSG „Obere Lachte, Kainbach, Jafelbach“.
Die Maßnahmen konzentrieren sich auf den Verlauf des Jafelbachs und bereiten auf die Rückverlegung des
Bachs in sein natürliches Bett vor. Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit nur geringen Niederschlägen
zeigt sich das Gebiet leider sehr trocken. Schlecht für unser erklärtes Ziel, aber eine wesentliche Erleichterung
für die Baumaßnahmen! Künftig soll das Gebiet wieder feuchter werden und sich das ursprüngliche Quell-
und Durchströmungsmoor des Jafelbachs regenerieren.
Gerade diese letzten sehr trockenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig Moore für das Klima und den Landschaftswasserhaushalt sind. Die besonderen Bedingungen im Moor entstehen im Zusammenspiel von hohen Wasserständen und der moortypischen Vegetation. Das im Moor stehende Wasser ist sauerstoffarm und sauer, zudem setzten die torfbildenden Moorpflanzen, die sogenannten Sphagnum-Moose, Gerbstoffe frei. Unter diesen Bedingungen können sich nur wenige bodenlebende Organismen ansiedeln, wodurch die Zersetzung abgestorbener Pflanzenteile nur stark verlangsamt ablaufen kann.
In der Bilanz wird dadurch in Mooren mehr Biomasse auf- als abgebaut. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass
das in der abgestorbenen Moorvegetation (Torf) gebundene CO2 dauerhaft gebunden und gespeichert bleibt. Wenn jedoch das Wasser fehlt, sei es durch aktive Entwässerung oder zu geringe Niederschläge, kommen die natürlichen Zersetzungsprozesse wieder in Gang. Die Konsequenz: Der gebundene Kohlenstoff kann als CO2 wieder in die Atmosphäre freigesetzt werden.
Durch ihren Aufbau wirken Moorböden zudem wie ein großer, natürlicher Wasserspeicher. Bei Regen können sie – wie ein Schwamm – große Mengen Wasser aufnehmen, und sie geben das Wasser nur langsam wieder an die Umgebung ab. Dadurch können z. B. durch Starkregenereignisse verursachte Hochwasserspitzen in Bächen und Flüssen reduziert und der Grundwasserspiegel auch in niederschlagsarmen Phasen auf einem hohen Niveau gehalten werden. Dies ist für die Wasserversorgung von Natur, Land- und Forstwirtschaft sehr wichtig.
Hintergrundinformationen
Artikel-Informationen
Ansprechpartner/in:
Walter Wimmer
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Rudolf-Steiner-Straße 5
38120 Braunschweig
Tel: +49 (0)531/88691-170
Fax: +49(0)531/ 886 91 - 270