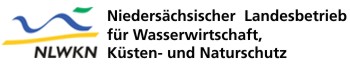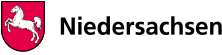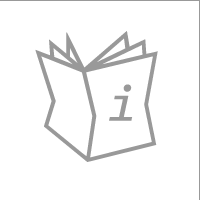
Damit Fische auf Wanderschaft gehen können: Baubeginn für Fischpass am Eisenbütteler Wehr
Startschuss für den Bau der Fischtreppe am Eisenbütteler Wehr in Braunschweig: Am Freitag hat der NLWKN in Braunschweig (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) mit dem 270.000 Euro teuren Projekt begonnen, das vom Land Niedersachsen und der Europäischen Union finanziert wird. Träger der Maßnahme ist der Wasserverband Mittlere Oker.
Der NLWKN baut in Braunschweig einen Kombinationsfischpass, weil die Wehranlage der Oker in Eisenbüttel nicht zu überwindende Barrieren für die Wanderfische sind. Und das wirkt sich negativ auf die Bestände bzw. Wiederansiedlungschancen der gefährdeten Wanderfische in der Oker aus. Denn Fische gehen grundsätzlich "auf Wanderschaft": Vor allem Lachse und Forellen wandern vom Meer stromaufwärts; um ihre Laichgebiete erreichen zu können; bei Aalen ist es übrigens genau umgekehrt. Neben den Wanderfischen lieben auch andere einheimische Fischarten den Ortswechsel innerhalb des Fließgewässersystems.
Am Eisenbütteler Wehr werden ein Raubettgerinne und ein Fischkanupass gebaut. Das Raubettgerinne als Fischauf- und -abstieg wird aus Wasserbausteinen im Sohlbereich und Findlingen zur Schaffung der Querriegel erstellt – so wird der Höhenunterschied vom Ober- zum Unterwasser allmählich abgebaut und die Fische und andere Kleinstlebewesen können pro-blemlos auf- und absteigen.
Der Fischkanupass im Nebenschluss kombiniert einen Fischauf- und abstieg mit einer Kanupassage und ermöglicht auch bodenlebenden Organismen die Wanderung. Diese Aufstiegsmöglichkeit besteht im Gegensatz zum Raubettgerinne aus elastischen Borstenplatten und Schotter oder Kies auf der Sohle. Die Fische schwimmen zwischen den Borstenplatten stromauf und –ab; die am Boden lebenden Organismen hingegen bewegen sich auf und ab in der lückenhaften Sohle. Ankommende Boote fahren über die Borsten hinweg. Bei zu geringer Tiefe geben die Borsten nach.
Und wie funktioniert der Kombinationsfischpass? Die Tiere werden mit einer künstlich erzeugten Strömung (Leitströmung) in den rund 33 Meter langen und 8,55 Meter breiten Fischpass gelockt. Sie durchqueren das Gerinne, um den Höhenunterschied von 1,50 Metern von Ober- zu Unterwasser zu überwinden und umgehen damit die ansonsten unüberwindliche Wehranlage.
Die Experten beim NLWKN sprechen bei dem Projekt auch gern von der Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Oker. Die Oker durchfließt von der Quelle bis zur Mündung in die Aller bei Müden die Regionen Harz, Börde und das Weser-Aller-Flachland und wurde als "Verbindungsgewässer" dieser Regionen in das Fließgewässerprogramm aufgenommen. Zahlreiche Stauanlagen und verbaute Streckenabschnitte haben diese Verbindungsfunktion der Oker erheblich eingeschränkt bzw. unterbrochen.
Ökologische Durchgängigkeit – das bedeutet auch, dass die natürlich vorkommenden Fischarten und weitere am Gewässer lebende Arten sich entwickeln, vermehren und so das natürliche Gleichgewicht erhalten können. Außerdem wird durch die Sohlgleite das Wasser der Oker mit Sauerstoff angereichert.
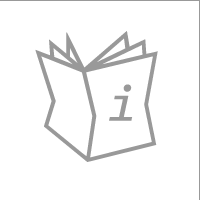
Artikel-Informationen
erstellt am:
22.07.2005
zuletzt aktualisiert am:
26.04.2010